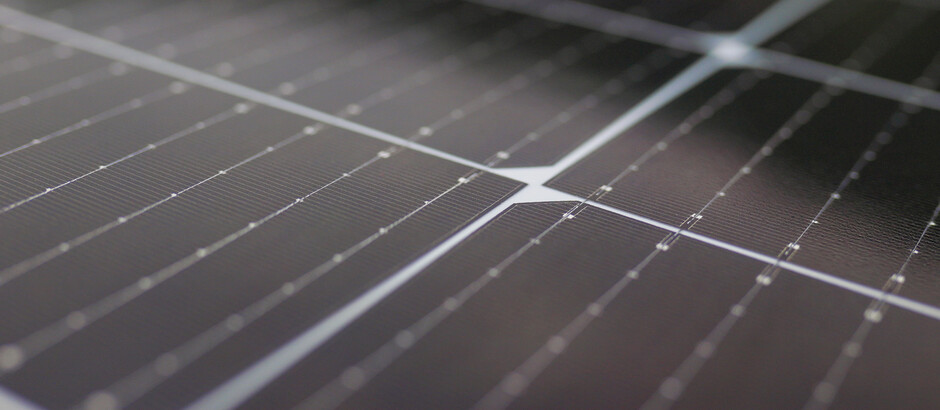Gesetzgebung zur Energiesicherheit
Noch vor wenigen Wochen war sie kaum bekannt - die fast 50 Jahre alte nationale Gesetzgebung zur Sicherung der Energieversorgung. Seit Wirtschaftsminister Habeck in der vergangenen Woche die Frühwarnstufe des Notfallplans Gas ausgerufen hat, ist sie aus ihrem Dornröschenschlaf geweckt worden. Vor allem will man wissen, welche Eingriffsrechte der Staat hat und wie die Abschaltung im Krisenfall geregelt ist.
Seit der Mitte der 70er Jahre gibt es in Deutschland in Folge der damaligen Ölkrise eine Gesetzgebung zur Energiesicherheit. Diese umfasst das Energiesicherheitsgesetz (EnSiG) und zwei auf Grundlage des EnSiG erlassene Verordnungen, die Gassicherungsverordnung (GasSV) und die Elektrizitätssicherungsverordnung (EltSV). Ein Regelwerk, das der Vorsorge dient und bislang nicht zur praktischen Anwendung kommen musste. Als die Autorin vor etlichen Jahren die Kommentierung übernahm, war nicht abzusehen, dass diese Vorschriften jemals relevant werden würden.
Erdgasversorgungssicherheit auf EU-Ebene
Vor über zehn Jahren, in Folge des ukrainisch-russischen Transitstreits, in dem vom 7. bis zum 20. Januar 2009 die Lieferung russischen Gases durch die Ukraine unterbrochen war, flammte das Sicherheitsthema unter dem Aspekt der Bewältigung von Gasversorgungskrisen schon einmal auf. Unter anderem als Folge dieser Ereignisse wurde der europäische Rechtsrahmen zur Gasversorgungssicherheit grundlegend überarbeitet. Heute gelten die in 2017 novellierten Regelungen der Erdgas-Versorgungssicherheits-Verordnung (Erdgas-SoS-VO).
Die Vorgaben der Erdgas-SoS-VO sind umgesetzt im Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), im EnSiG 1975 sowie in der zum EnSiG erlassenen Verordnung zur Sicherung der Gasversorgung in einer Versorgungskrise (Gassicherungsverordnung – GasSV).
Anwendungsbereich des EnSiG
Auf nationaler Ebene wurde in der Vergangenheit durchaus darüber nachgedacht, die Vorschriften des EnSiG - ggf. nach einer Reform - als Rechtsgrundlage für die Verpflichtung von Kraftwerksbetreibern zu einer Notreserve im Dienste der Netzstabilisierung oder eine Verpflichtung von Netzbetreibern zum Netzausbau zu begründen. Auch wurde erwogen, gestützt auf das EnSiG, die Betreiber von Gasspeicheranlagen in verbrauchsarmen Zeiten zur Einspeicherung von Erdgas zu verpflichten. Zu diesen Anwendungsfällen kam es aber nicht: Die Versorgungssicherheit mit Blick auf Reservekraftwerke sowie die Netzsicherheit wurde mittlerweile EnWG geregelt. Und das jüngste Projekt der Bundesregierung, durch das Gesetz zur Nationalen Gasreserve für einen hohen Füllstand der Gasspeicher zu sorgen, soll ebenfalls unabhängig von den Vorschriften des Energiesicherheitsrechts über eine Novelle des EnWG konzipiert werden.
Was regeln nun das EnSiG und die beiden Sicherheitsverordnungen? Diese Gesetzgebung gilt für den Fall von Energieversorgungsstörungen erheblichen Ausmaßes - und zwar für Versorgungskrisen mit zivilem Hintergrund. Für Versorgungskrisen im Spannungs- und Verteidigungsfall gelten die besonderen Regelungen des Wirtschaftssicherstellungsgesetzes. Der Ukraine-Krieg kann in diesem Sinne zu einem zivilen Störungsfall werden, weil sich der Spannungs- und Verteidigungsfall nicht auf das Territorium der Bundesrepublik Deutschland bezieht.
Energiesicherheitsrecht in der "Notfallstufe"
Das EnSiG betrifft die dritte Krisenstufe nach der Frühwarnstufe und der Alarmstufe - die Notfallstufe. In dieser kann der Staat in den Gasmarkt eingreifen, da dann die Energieversorgung "unmittelbar gefährdet" oder sogar "gestört" sein kann. Marktgerechte Maßnahmen können die Gefährdung oder Störung nicht beheben, weshalb zur Sicherung der Deckung des „lebenswichtigen Bedarfs“ hoheitliche Eingriffe erforderlich werden. Hierzu kann die Bundesregierung das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz - bzw. mit Blick auf die leitungsgebundene Erdgasversorgung - die Bundesnetzagentur durch Rechtsverordnung ermächtigen, in den Markt einzugreifen. Es kann vorgesehen werden, dass die Abgabe, der Bezug oder die Verwendung der Güter zeitlich, örtlich oder mengenmäßig beschränkt wird, oder nur für bestimmte vordringliche Versorgungszwecke vorgenommen werden darf.
Sogar in bestehende Verträge kann eingegriffen werden. Vor allem die Regelung der Verteilung des Erdgases würde die Kunden unmittelbar betreffen. Ganz konkret: Die Behörde agiert dann als "Lastverteiler" und kann Unternehmen, die Erdgas beziehen oder abgeben, aber auch Verbraucher durch Verfügung unter Fristsetzung verpflichten, ihre Gaslieferverträge zu ändern. Sogar ein "angemessenes Entgelt" für die Gaslieferungen kann behördlich festgesetzt werden.
Regelungen über die Entschädigung von Enteignungen runden diese Gesetzgebung ab. Zur praktischen Anwendung wird es hoffentlich nicht kommen.
Einschränkungen des motorisierten Verkehrs
Was ist noch möglich? Die Benutzung von Motorfahrzeugen aller Art könnte nach Ort, Zeit, Strecke, Geschwindigkeit und Benutzerkreis sowie Erforderlichkeit der Benutzung eingeschränkt werden. Bis hin zu Fahrverboten. Das gab es übrigens 1974 in der Ölkrise auf der Grundlage des Vorgängergesetzes zum EnSiG 1975 schon einmal. Ein Tempolimit auf Autobahnen wäre auch möglich. Dafür bräuchte es im Übrigen keine Energiekrise im Sinne des EnSiG; auch könnte man E-Fahrzeuge ausnehmen.
Schutz der Erdgasversorgung von Haushaltskunden
Seit Juli 2005 gilt ergänzend § 53a EnWG zur Sicherstellung der Versorgung von Haushaltskunden mit Erdgas. Vorrangig sichergestellt werden soll auch die Erdgasbelieferung von Fernwärmeanlagen, die Haushaltskunden beliefern.
Die derzeitige Diskussion über mögliche Abschaltreihenfolgen nimmt hier ihren Ausgangspunkt. Welche Entscheidungen hier richtig sind, ist nicht einfach zu beantworten. Aber etwa die Frage, ob ein Bürger eher auf seinen Arbeitsplatz verzichten würde als (vorübergehend) auf eine warme Wohnung, sollte rein vorsorglich gestellt werden, auch wenn sie unbequem ist.